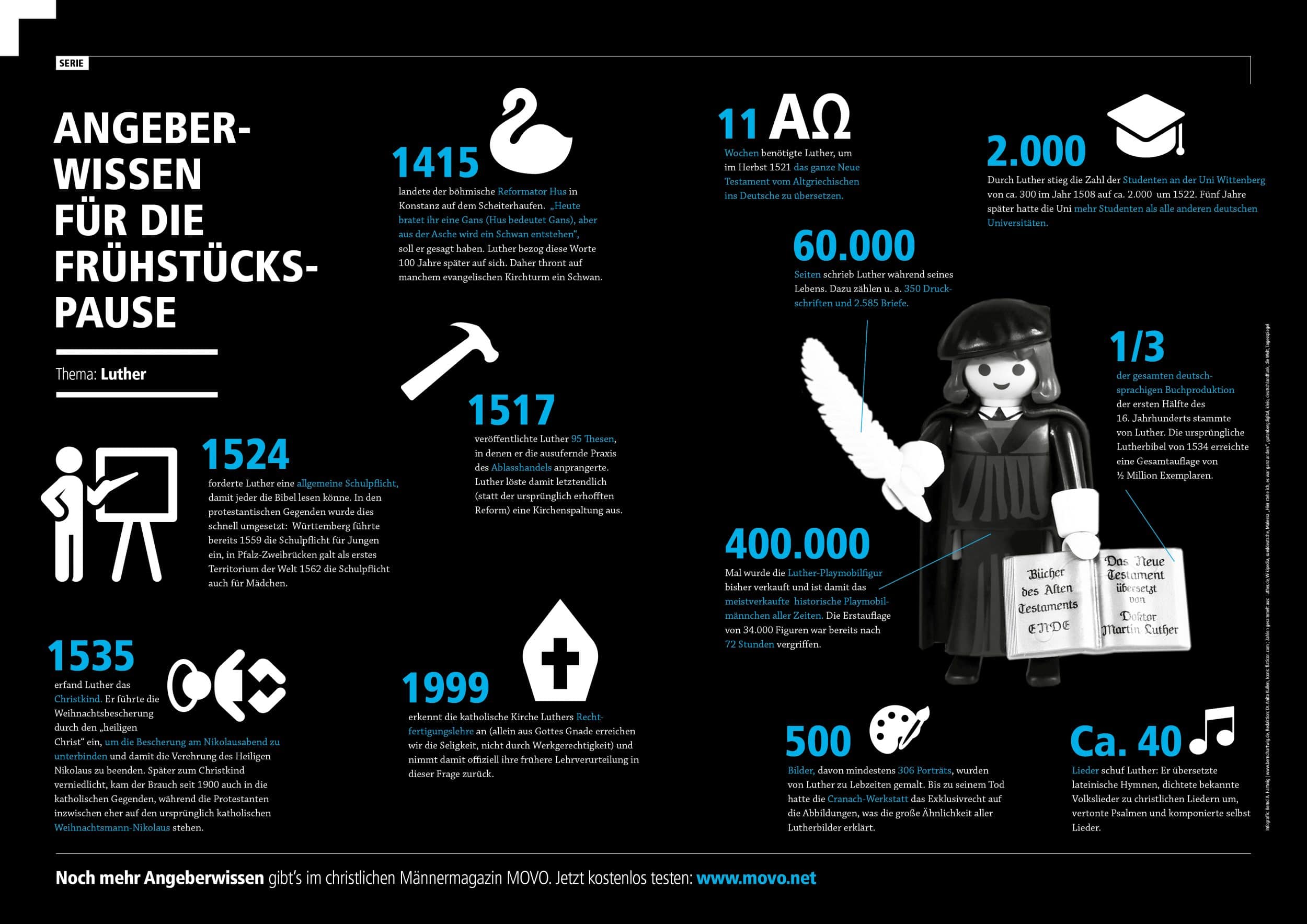Erziehe dich selbst
Dr. Ulrich Wendel
Manoachs Frau weiß, was man von Gott erwarten kann
Vielen Menschen in der Bibel begegnen uns nach einem altbekannten Muster: Den Namen des Mannes erfahren wir, den der Frau nicht. So ist das oft in der altorientalischen Kultur. Wer namenlos bleibt, ist offenbar nicht so wichtig.
Immer wieder aber bricht die Bibel dieses Schema auf. So ist es auch bei Manoachs Frau. Ja, auch hier wissen wir nur, wie ihr Mann heißt, und ihren eigenen Namen kennen wir nicht. Doch wie Gott dieser Frau begegnet, ist bemerkenswert. In Richter 13 erfahren wir davon.
Das Ehepaar lebt in Zora im Hügelland Judäas. Wie viele andere Frauen kann auch Manoachs Frau zunächst keine Kinder bekommen – bis ein Bote Gottes ihr einen Sohn ankündigt. Und zwar wird es ein besonderer Sohn sein, ein Gottgeweihter, ein „Nasiräer“ (wie der biblische Ausdruck lautet). Solche Männer oder Frauen lebten eine Zeitlang enthaltsam im Blick auf Alkohol und unreine Speise, und auch die Mutter – so der Bote – soll diese Vorschriften während der Schwangerschaft einhalten.
Der Vater will es wissen
Wie reagiert man, wenn Gottes Bote einen anspricht? Die Frau läuft zuerst zu ihrem Mann und berichtet ihm alles. Manoach geht sofort ins Gebet. Und zwar will er von Gott wissen: Wenn sie nun einen so besonderen Sohn bekommen sollten – wie sollen sie mit ihm umgehen? Was ist zu beachten? Gott möge den Boten noch einmal schicken, damit der Auskunft erteilt. Manoachs Gebet wird erhört. Der Engel Gottes kommt wenig später tatsächlich – aber nicht zu Manoach, der gebetet hat, sondern wieder zu seiner Frau. Ja, offenbar bewusst nur zu ihr, denn er sucht sie auf, als sie allein auf dem Feld ist. Gott geht hier recht einseitig vor. Obwohl Manoach sich als treuer Glaubender erweist, der seine Anliegen spontan ins Gebet bringt, übergeht Gott ihn und wendet sich allein an seine Frau – sie ist Gottes erste Adresse, sie will er in dieser Angelegenheit als Gesprächspartnerin haben. Dass die Frau für uns namenlos bleibt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gott sie sehr wohl im Blick hat.
Sie reagiert bei dieser zweiten Engels-Begegnung genauso wie bei der ersten: Sie läuft zu ihrem Mann und informiert ihn. Der geht sofort los, um mit dem Boten Gottes zu reden. Das ist die Gelegenheit für Manoach, seine Frage zu wiederholen, die ihn beschäftigt: Wie sollen sie mit dem Jungen umgehen, wenn er zur Welt gekommen ist? „Was soll sein Verhalten sein?“, will er wissen (Richter 13,12). Manoach ist ein werdender Vater, der Interesse an seinem künftigen Sohn hat. Er kümmert sich um Erziehungsfragen und empfindet Verantwortung für den Weg des Kindes. Man könnte meinen, Gott würde einem solchen Interesse gern entgegenkommen und den so erziehungs-begierigen Vater ausführlich in seine Aufgabe einweisen. Doch die Antwort des Boten ist recht ernüchternd: Er wiederholt bloß das, was er bereits zu vor der werdenden Mutter gesagt hat. Mehr muss man nicht wissen. Das könnte eine wichtige Lebenslektion sein, über die besondere Situation von Manoach hinaus: Manchmal bestürmt man Gott mit Fragen, die er längst beantwortet hat, und anstatt auf eine neue Antwort zu warten, sollte man sich hinsetzen und überlegen, wie man das befolgt, was man bisher schon gehört hat.
Erziehungstipps? Fehlanzeige!
Aber was ist es genau, das Manoachs Frau gehört hat? Die Antwort des Gottesboten hat – bei genauer Betrachtung – eine Überraschung bereit. Manoach will etwas über Erziehung erfahren. Ihm geht es darum zu wissen, was der Junge in seinem Leben tun und lassen soll – zu diesem Verhalten, so scheint er zu denken, will er ihn dann anleiten. Doch Gottes Auskunft sagt nichts darüber, wie der Junge sich verhalten soll, sondern nur, wie die Mutter leben soll! Und zwar wie sie ihr eigenes Leben leben soll, nicht, wie sie als Mutter sein soll. Während der Schwangerschaft soll sie sich so ernähren, wie es ein gottgeweihter Mensch tut – das ist alles. Vielleicht will Gott sie damit herausfordern, dass sie auf ihre eigene Beziehung zu ihm Wert legt, dass sie sich also eine Zeitlang ihm weiht, so wie es dann für ihren Sohn später lebenslang gelten soll. Jedenfalls erfahren Manoach und seine Frau nichts über Kindererziehung für Nasiräer, sondern über den Umgang mit sich selbst. „Erziehe dich selbst“ scheint – zugespitzt gesagt – Gottes Antwort auf die Erziehungsfragen der Eltern zu sein.
Nein, wir müssen nicht sterben.
Nach dieser Begegnung bleibt Manoach nur noch, dem Gast alle gebührende Gastfreundschaft zu erweisen, so wie es im alten Orient unantastbare Sitte ist. Er will ihn mit einem leckeren Ziegenbock bewirten und er fragt nach dem Namen des Mannes – Manoach hat noch nicht erkannt, dass es ein Engel ist. Doch der Mann lehnt beides ab, die Bewirtung und dass er seinen Namen nennt. Er hat aber einen Gegenvorschlag: Wenn Manoach da gerade schon einen Ziegenbock parat hat, könnte er ihn als Brandopfer für Gott bringen. So macht Manoach es denn auch – und erlebt plötzlich einen heiligen Moment: Als die Flamme vom Altar auflodert, fährt der Engel in diesem Feuer nach oben zum Himmel! Jetzt wird Manoach klar, mit wem er es her die ganze Zeit zu tun hatte – eben mit einem Engel des Herrn! Und er reagiert panisch. „Wir müssen sterben! Wir haben ja Gott gesehen!“ Doch seine Frau behält die Nerven – ja mehr noch: Sie legt geistliche Einsicht und Weisheit an den Tag. Wenn Gott sie hätte töten wollen, dann hätte er ja wohl das Opfer nicht von ihnen angenommen und hätte vorher nicht mit ihnen geredet. Manoachs Frau scheint Gottes Absichten besser zu begreifen als er – so wie Gott ja zuvor sie und nicht ihren Mann als Gesprächspartnerin ausgewählt hat. Manoach erschrickt vor dem Gesetz Gottes („Wer Gott sieht, muss sterben“; siehe 2. Mose 33,20) und befürchtet den Tod, doch die Frau erfasst etwas vom Evangelium und erwartet das Leben.
Der Sohn, der dann zur Welt kommt, ist Simson – einer der Richter und Befreier Israels. Er hat sich in der Bibel einen Namen gemacht, bis hinein ins Neue Testament (Hebräer 11,32). Seine Mutter bliebt namenlos, doch wir lernen sie als Frau kennen, mit der Gott redet, der Gott aufträgt, auf ihr eigenes Leben zu achten, und die ein Gespür dafür hat, was man von Gott erwarten kann.
Dieser Artikel erschien in Faszination Bibel. Jetzt kostenlos testen: www.faszination-bibel.net